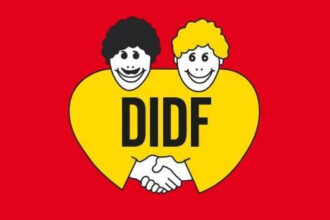Übernommen von Yeni Hayat / Neues Leben:
Yücel Demirer
Am 10. April traf sich Präsident Erdoğan mit der sogenannten „İmralı-Delegation der DEM-Partei“, bestehend aus Pervin Buldan und Sırrı Süreyya Önder. Ursprünglich hätte das Treffen früher stattfinden sollen, aber wegen der Verhaftungswelle am 19. März (Verhaftung von İmamoğlu und den folgenden Protesten) und des Ramadan-Festes wurde es vertagt. Jetzt kommt wieder Bewegung in den Lösungsprozess. In einer Erklärung der DEM-Partei wurde das Treffen als „äußerst positiv, konstruktiv, produktiv und hoffnungsvoll im Hinblick auf die Zukunft“ bezeichnet.
Einige Tage vor dem Treffen hatte die Co-Vorsitzende der DEM-Partei, Tülay Hatimoğulları, erklärt, dass man nach Öcalans Aufruf, in dem dieser forderte, dass der Staat die nötige Sicherheit im Falle einer Auflösung der PKK garantieren solle, keine konkreten Schritte seitens der Regierung erkennen könne. Am darauffolgenden Tag erklärte Tuncer Bakırhan, der zweite Co-Vorsitzende der DEM-Partei: „Je mehr man sich davor scheut, über Frieden zu sprechen, je länger man es aufschiebt und je mehr antidemokratische Praktiken – wie aktuell in Istanbul – zunehmen, desto weniger Vertrauen kann aufgebaut werden. Wie sollen die Kurden und die Werktätigen noch glauben?“
Die Ablehnung des Wunsches der DEM-Partei, mit einer größeren Delegation am Treffen mit Erdoğan teilzunehmen, sowie die bereits vorab bekannt gewordene Absage von Ahmet Türk – einem prominenten Teilnehmer früherer Gespräche – aufgrund gesundheitlicher Probleme wurde öffentlich diskutiert. Zusammen mit dem Vorschlag von MHP-Chef Devlet Bahçeli, die PKK solle ihren Auflösungskongress in Muş-Malazgirt abhalten, zeigt sich erneut der Wille der Regierungskoalition (Cumhur İttifakı), ihre absolute Kontrolle über den Prozess sichtbar zu machen.
Kommentatoren aus unterschiedlichen Kreisen werten die Einbeziehung von Efkan Ala (stellvertretender AKP-Vorsitzender) und İbrahim Kalın (Chef des türkischen Geheimdienstes MIT) in das Treffen als Zeichen einer gemäßigten Haltung und als Bestätigung, dass Erdoğan den Prozess erneut für sich beansprucht – womöglich auch auf eine nächste Stufe heben will.
Zugleich wecken bestimmte Aussagen in Abdullah Öcalans „Aufruftext“ sowie die mögliche strategische Einbindung des Prozesses in das Ziel der Regierungskoalition, ihre politische Lebensdauer zu verlängern, berechtigte Sorgen. All das macht eine aufmerksame Beobachtung des Prozesses unerlässlich.
Am 15. März 2025 nahm ich mit einem Vortrag unter dem Titel „Der brüchige Boden des Friedens und seine aktuellen Grenzen“ an der 3. Friedenskonferenz teil, die von der KESK in Istanbul organisiert wurde. Die Zusammenfassung des ersten Teils meines Vortrags, in dem ich die politischen Dynamiken des Prozesses bewertete, hatte ich bereits an dieser Stelle geteilt. Nun möchte ich – im Lichte des jüngsten Treffens – auch die zweite Hälfte meines Vortrags veröffentlichen, die sich mit aktuellen Begrenzungen des Lösungsprozesses befasst.
Aktuelle politische Grenzen des Friedens
Neben strukturellen Problemen beeinflussen auch aktuelle politische Entwicklungen und Fragen der Verhandlungstechnik den Lösungsprozess. Diese Einschränkungen lassen sich in politische und technische Probleme unterteilen:
Politische Begrenzungen:
- Die Rhetorik à la „Entweder ihr ergebt euch vollständig oder der eiserne Schlag trifft euch“. Aussagen wie „Es gibt kein Kurdenproblem“ oder „Der Lösungsprozess steht nicht auf unserer Agenda“ ziehen die Grenzen eines Prozesses, der kaum Raum für Verhandlungen lässt.
- Die bewusste Auswahl und gleichzeitige Ausgrenzung von Verhandlungspartnern durch die Regierung mit dem Ziel, alleiniger Entscheidungsträger zu sein und politische Vorteile daraus zu ziehen. Damit schwächt sie sowohl die gewählten als auch die ausgegrenzten Stimmen.
- Fortdauernde Repressionen, Zwangsverwalter (Kayyım), die Diskussion um Erdoğans erneute Kandidatur und ein nationalistischer Wettstreit unter Parteien, der sich über eine Gegnerschaft zum Friedensprozess definiert.
- Der Wunsch der Regierung, die ausgewogene Beziehung der größten Oppositionspartei CHP zur kurdischen Politik zu stören, sowie das Versäumnis der CHP, eine kohärente und umfassende Haltung oder gar eigene Lösungsvorschläge zum Friedensprozess zu entwickeln.
Technische Notwendigkeiten des Friedensprozesses
Friedensprozesse erfordern bestimmte, international anerkannte technische Voraussetzungen. Aktuell lassen sich folgende Mängel identifizieren:
- Unklar definierte Ziele, fehlende Zeitpläne, das Ausbleiben vertrauensbildender Maßnahmen sowie das Fehlen von Mechanismen zur Erfassung der gesellschaftlichen Stimmung auf beiden Seiten. Der Prozess benötigt dringend mehr Inklusivität.
- Die Bevölkerung wurde nicht ausreichend psychologisch auf den langen, widerstandsfähigen Übergangsprozess vorbereitet. Es fehlt an Bemühungen, bei politischen Akteuren realistische Erwartungen zu etablieren sowie an Kanälen zur transparenten Information der Öffentlichkeit.
- Es wurden keine Mechanismen zur Einbeziehung der Zivilgesellschaft geschaffen, der direkte Einbezug von Betroffenen findet nicht statt, und es fehlt eine Delegation mit echter Repräsentationskraft.
Demokratischer Rückbau als globaler Kontext
Die schwedischen Wissenschaftler Anna Lührmann und Staffan I. Lindberg analysieren in ihrem Artikel „A Third Wave of Autocratization is Here: What is New About it?“ die Entwicklung von Demokratien in 182 Ländern zwischen 1900 und 2017. Sie identifizieren eine dritte Welle der Autokratisierung, bei der Demokratien nicht durch Putsche oder äußere Besetzungen, sondern unter legalem Anschein schrittweise zurückgebaut werden. Auch die Türkei zählt laut ihrer Studie zu den Ländern mit rückläufiger Demokratie.
Zahlreiche Studien bestätigen diese Einschätzung. Sie zeigen, dass der Friedensprozess in einem Land stattfindet, in dem das Recht dem politischen Kalkül dient, Institutionen entkernt, politische Teilhabe durch Interessen gelenkt und Beamte wie Parteikader handeln. All dies macht deutlich: Wir dürfen aktuelle Repressionen und strukturelle Schwächen nicht vergessen. Friedensunterstützung muss mit kritischem Denken einhergehen – das ist unsere historische Verantwortung.
Frieden bedeutet nicht Absicht, sondern Ergebnis
Als Menschen, deren Angehörige in ihren Betten gestorben sind, steht es uns nicht zu, dem kurdischen Volk Ratschläge zu erteilen. Dennoch liegt es an uns, die politischen und ideologischen Aussagen in Öcalans Aufruf sowie die erkennbaren Schwächen im bisherigen Prozess kritisch zu bewerten. Das ist unsere neue Verantwortung.
Wir sollten uns an ein Zitat von Pablo Picasso aus dem Mai 1923 erinnern, wenn wir statt „Kunst“ oder „Malerei“ das Wort „Frieden“ einsetzen:
„Wenn ich male, geht es mir darum, das zu zeigen, was ich gefunden habe – nicht das, was ich gesucht habe. In der Kunst zählen Absichten nicht. Wie man im Spanischen sagt: Liebe muss durch Taten, nicht durch Gründe bewiesen werden. Was zählt, ist nicht die Absicht am Anfang, sondern was tatsächlich gemacht und gezeigt wurde.“
Quelle: Yeni Hayat / Neues Leben